
Die meisten IT-Investitionen scheitern nicht an der Technik, sondern an der fehlenden Fokussierung auf den tatsächlichen Geschäftswert.
- Bis zu 60% der IT-Ausgaben verpuffen, weil Projekte nicht konsequent an Business-KPIs ausgerichtet sind.
- Das Pareto-Prinzip (80/20-Regel) bietet einen rigorosen Rahmen, um die 20% der Initiativen zu identifizieren, die 80% des Business-Impacts liefern.
Empfehlung: Ersetzen Sie Ihre traditionelle, technologiegetriebene Roadmap durch eine wertorientierte Priorisierung, die Initiativen nach ihrem direkten Beitrag zu strategischen Unternehmenszielen bewertet und nicht nach Hype-Faktoren.
Für viele CIOs und IT-Verantwortliche ist es ein vertrautes Szenario: Das Budget ist knapp, der Druck zur Digitalisierung enorm, und am Ende des Jahres ist unklar, welchen konkreten Geschäftswert die getätigten Millionen-Investitionen eigentlich erbracht haben. Man spricht über Cloud-Migration, implementiert KI-Piloten und modernisiert die Infrastruktur. Doch die erhoffte Revolution bei Effizienz, Umsatz oder Kundenzufriedenheit bleibt oft aus. Viele IT-Abteilungen agieren in einem Teufelskreis aus reaktiver Problemlösung und dem Versuch, technologisch Schritt zu halten, anstatt proaktiv Werte zu schaffen.
Die gängige Antwort darauf ist der Ruf nach einer besseren „Ausrichtung von IT und Business“. Doch dieser Ratschlag bleibt oft eine leere Phrase. Was, wenn der Schlüssel nicht in vagen Strategiemeetings liegt, sondern in einem einfachen, aber radikalen Prinzip? Was, wenn die Lösung darin besteht, bewusst auf 80% der möglichen IT-Initiativen zu verzichten, um sich mit laserscharfem Fokus auf die 20% zu konzentrieren, die den Unterschied machen? Genau hier setzt das Pareto-Prinzip an. Es ist kein reines Zeitmanagement-Tool, sondern ein strategischer Wertschöpfungshebel für IT-Investitionen.
Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie das 80/20-Prinzip systematisch anwenden, um Ihre IT von einem Cost-Center zu einem schlagkräftigen Business-Enabler zu transformieren. Wir werden die Ursachen für verschwendete IT-Budgets analysieren, Ihnen einen konkreten 6-Schritte-Plan zur Erstellung einer wertorientierten Roadmap an die Hand geben und Ihnen zeigen, wie Sie kostspielige Fehler bei Hype-Technologien und Legacy-Systemen vermeiden.
Um diese strategische Neuausrichtung strukturiert anzugehen, führt dieser Leitfaden Sie durch die zentralen Hebel zur Maximierung Ihres IT-ROIs. Die folgende Übersicht zeigt die Themen, die wir im Detail behandeln werden.
Inhaltsverzeichnis: Strategischer Technologie-Einsatz mit dem Pareto-Prinzip
- Warum verpuffen 60% aller IT-Investitionen ohne messbaren Business-Impact: Die Lücke zwischen Technologie und Geschäftsstrategie?
- Wie Sie eine IT-Roadmap in 6 Schritten erstellen, die Technologie-Initiativen nach Geschäftswert statt nach IT-Trends priorisiert?
- Best-of-Breed oder integrierte Suite: Welcher IT-Architekturansatz passt zu Ihrer Systemlandschaft und IT-Kompetenz?
- Der Hype-Fehler, der IT-Abteilungen dazu bringt, 200.000 € in Blockchain oder KI zu investieren, ohne konkreten Anwendungsfall
- Wann sollten Sie Legacy-Systeme modernisieren statt ersetzen: Die 4 Kriterien, die eine 3-Millionen-Fehlinvestition verhindern?
- Der Anfängerfehler, der 70% aller E-Learning-Teilnehmer in den ersten 3 Wochen zum Aufgeben zwingt
- Warum verschwenden Ihre Mitarbeiter 30% ihrer Arbeitszeit mit Aufgaben, die keinen Kundenmehrwert schaffen: Die 7 Formen der Verschwendung?
- Das vernetzte Zuhause: Wie Smart-Home-Systeme Ihnen 450 € Energiekosten pro Jahr sparen, ohne Komfortverlust
Warum verpuffen 60% aller IT-Investitionen ohne messbaren Business-Impact: Die Lücke zwischen Technologie und Geschäftsstrategie?
Die ernüchternde Realität in vielen Unternehmen ist, dass ein erheblicher Teil der IT-Ausgaben keine nachweisbare Rendite erzielt. Es wird investiert, implementiert und administriert, doch der messbare Beitrag zum Unternehmenserfolg bleibt unklar. Dieses Phänomen ist keine Folge schlechter Technologie, sondern einer tiefen Kluft zwischen technologischen Initiativen und strategischen Geschäftszielen. Die Zahlen sprechen für sich: laut einer aktuellen IBM-Studie nur 41% der deutschen Unternehmen einen positiven ROI aus ihren KI-Investitionen erzielen. Die Gründe dafür sind systematisch und wiederholen sich unternehmensübergreifend.
Ein zentrales Problem ist die fehlende Messbarkeit. Projekte werden oft mit technischen Zielen gestartet (z.B. „Einführung eines neuen CRM-Systems“), ohne im Vorfeld klare Business-KPIs zu definieren (z.B. „Reduzierung der Kundenabwanderung um 15%“). Ohne eine solche quantitative Zielgrösse wird die Erfolgsmessung subjektiv und beliebig. Zweitens führen Governance-Defizite zu massiver Verschwendung. Unkontrollierte Cloud-Ausgaben oder mangelnde Lizenzverwaltung sind nur Symptome einer fehlenden strategischen Steuerung. Der Fokus liegt auf der technischen Bereitstellung, nicht auf der wirtschaftlichen Nutzung.
Ein dritter kritischer Punkt sind Skalierungsprobleme. Viele vielversprechende Pilotprojekte, insbesondere im Bereich KI, schaffen nie den Sprung in den produktiven Regelbetrieb. Der Kyndryl Readiness Report 2025 bestätigt dies eindrücklich: 62 Prozent der Unternehmen verharren in der Experimentierphase, weil die Prozesse zur Industrialisierung (z.B. MLOps) fehlen. So werden aus potenziellen Werttreibern teure Technologiespielplätze ohne Business-Impact. Diese Lücke zwischen Aktivität und Ergebnis ist der Nährboden für das Pareto-Prinzip.
Wie Sie eine IT-Roadmap in 6 Schritten erstellen, die Technologie-Initiativen nach Geschäftswert statt nach IT-Trends priorisiert?
Eine wertorientierte IT-Roadmap ist das wirksamste Instrument, um das Pareto-Prinzip in die Praxis umzusetzen. Statt einer langen Wunschliste an Technologien erstellen Sie ein dynamisches Portfolio, das jede Initiative nach ihrem potenziellen Beitrag zum Geschäftserfolg bewertet. Dies erfordert einen fundamentalen Wandel von einer technologiegetriebenen zu einer wertgetriebenen Denkweise. In sechs Schritten können Sie eine solche Roadmap aufbauen und so Ihre Investitionen auf die wirklich wichtigen 20% fokussieren.
Schritt 1 & 2: Geschäftsziele verstehen und Business-KPIs ableiten. Analysieren Sie die Top-3-Unternehmensziele für die nächsten 18 Monate (z.B. Erhöhung des Marktanteils, Steigerung der operativen Effizienz). Leiten Sie daraus messbare KPIs ab (z.B. Customer Lifetime Value, Time-to-Market, Prozesskosten pro Transaktion).
Schritt 3 & 4: Initiativen sammeln und in der Value-vs.-Enabler-Matrix verorten. Sammeln Sie alle potenziellen IT-Initiativen. Bewerten Sie jede Initiative auf zwei Achsen: „Business Value“ (direkter Beitrag zu den KPIs) und „Enabler-Faktor“ (Schaffung von Grundlagen für zukünftigen Wert). So trennen Sie schnell strategische Leuchtturmprojekte von reinen Infrastrukturmassnahmen.

Schritt 5 & 6: Initiativen priorisieren und quartalsweise neu bewerten. Fokussieren Sie sich auf die Initiativen im Quadranten „High Value / High Enabler“. Dies sind Ihre 20%, die 80% des Werts liefern. Verabschieden Sie sich von einer starren Jahresplanung. Eine agile, quartalsweise Neubewertung der Prioritäten stellt sicher, dass Ihre Roadmap stets auf die aktuellen Geschäftsbedürfnisse ausgerichtet ist.
Der fundamentale Unterschied zwischen einer traditionellen und einer wertorientierten Roadmap liegt im Fokus. Statt technischer Metriken stehen knallharte Geschäftskennzahlen im Mittelpunkt.
| Kriterium | Traditionelle Priorisierung | Value-orientierte Priorisierung |
|---|---|---|
| Fokus | Technische KPIs (Uptime, Ticketlösung) | Business KPIs (Customer Lifetime Value, Time-to-Market) |
| Bewertungsrhythmus | Jährliche starre Roadmap | Quartalsweise Neubewertung |
| ROI-Betrachtung | Nur direkte Kosteneinsparungen | Inkl. indirekter Werte (Risikominimierung, Mitarbeiterzufriedenheit) |
| Erfolgsquote | ~40% positive ROI | Potenziell 60-70% durch gezielte Priorisierung |
Best-of-Breed oder integrierte Suite: Welcher IT-Architekturansatz passt zu Ihrer Systemlandschaft und IT-Kompetenz?
Die strategische Entscheidung zwischen einem „Best-of-Breed“-Ansatz (Auswahl der besten Einzellösung für jeden Zweck) und einer integrierten Suite (eine umfassende Lösung von einem Anbieter, z.B. ein grosses ERP-System) ist ein klassisches Dilemma für CIOs. Das Pareto-Prinzip bietet hier eine klare Entscheidungshilfe: Der Fokus sollte auf der Maximierung des Werts liegen, nicht auf der Maximierung der Funktionen. Oft generieren nur 20% der Software-Features 80% des tatsächlichen Geschäftswerts. Eine teure Suite, deren Funktionen zu 80% ungenutzt bleiben, ist eine klassische Form der Verschwendung.
Ein Best-of-Breed-Ansatz ermöglicht es, gezielt in die spezialisierten Tools zu investieren, die die kritischsten 20% der Geschäftsprozesse optimal unterstützen. Dies führt zu höherer Flexibilität und potenziell besseren Ergebnissen in den Kernbereichen. Der Nachteil sind höhere Integrationsaufwände und eine komplexere Systemlandschaft. Dieser Ansatz eignet sich für Unternehmen mit starker interner IT-Kompetenz, die in der Lage ist, die Schnittstellen zwischen den Systemen zu managen und die Gesamtarchitektur zu überblicken.
Eine integrierte Suite hingegen verspricht Einfachheit durch eine zentrale Datenhaltung und vorintegrierte Prozesse. Der Preis dafür ist oft eine geringere Flexibilität und die Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter. Dieser Ansatz kann sinnvoll sein, wenn Standardprozesse im Vordergrund stehen und die internen IT-Ressourcen für komplexe Integrationsprojekte begrenzt sind. Die Gefahr liegt jedoch darin, für einen riesigen Funktionsumfang zu bezahlen, von dem nur ein Bruchteil einen echten Wertbeitrag leistet – ein klarer Verstoss gegen das Pareto-Prinzip, wie Computer Weekly in ihrer Analyse aufzeigt, dass oft 20% der Fehler 80% der Ausfälle verursachen, was auch für Software-Nutzung gilt.
Fallbeispiel: Pareto-Prinzip in der Produktionsoptimierung
Ein Produktionsunternehmen nutzte eine spezialisierte Best-of-Breed-Lösung zur Prozessanalyse und stellte fest, dass 80% der Maschinenstillstände von nur 20% der Störungsarten verursacht wurden. Anstatt eine teure, allumfassende Produktionsplanungs-Suite zu implementieren, fokussierte das Unternehmen seine Ressourcen gezielt auf die Behebung dieser wenigen, aber kritischen Fehlerquellen. Das Ergebnis war eine schnellere, ressourcenschonendere Problemlösung und eine signifikante Steigerung der Gesamtanlageneffektivität, was den Wert eines fokussierten Ansatzes beweist.
Der Hype-Fehler, der IT-Abteilungen dazu bringt, 200.000 € in Blockchain oder KI zu investieren, ohne konkreten Anwendungsfall
Der Druck, innovativ zu sein, verleitet viele IT-Abteilungen dazu, auf jeden neuen Technologie-Hype aufzuspringen. Ob KI, Blockchain oder Quantum Computing – die Angst, den Anschluss zu verpassen (FOMO), führt oft zu erheblichen Investitionen, bevor überhaupt ein valider Business Case existiert. Dies ist der „Hype-Fehler“: Die Technologie wird zum Selbstzweck, losgelöst von einem messbaren Problem oder einer konkreten Wertschöpfung. Der Kyndryl Readiness Report 2025 zeigt paradoxerweise eine geplante Steigerung der KI-Investitionen um 33%, obwohl 46% der Unternehmen bisher keinen positiven ROI sehen. Es wird mehr Geld in ein Problem investiert, dessen Ursache nicht die Technologie, sondern die falsche Herangehensweise ist.
Um diese Falle zu vermeiden, ist ein radikaler Wandel vom „Proof of Concept“ (PoC) zum „Proof of Value“ (PoV) erforderlich. Ein PoC beweist nur, dass eine Technologie technisch funktioniert. Ein PoV beweist, dass eine Technologie einen messbaren Geschäftswert liefert. Genau hier setzt das Pareto-Prinzip an: Anstatt 10 PoCs zu starten, konzentrieren Sie sich auf zwei PoVs für die vielversprechendsten Anwendungsfälle. Der Fokus verschiebt sich von der technischen Machbarkeit zur wirtschaftlichen Rentabilität. Bevor auch nur eine Zeile Code geschrieben wird, muss die Frage „Welches Business-KPI wollen wir um wie viel Prozent verbessern?“ beantwortet sein.
Dieser Ansatz erfordert Disziplin und die Bereitschaft, Projekte frühzeitig zu beenden, wenn sie keinen Wertnachweis erbringen. Klare „Kill-Kriterien“ sind dabei unerlässlich. Eine Investition von 5.000 € in einen gescheiterten PoV ist ein Erfolg, denn sie verhindert eine Fehlinvestition von 200.000 € in ein nutzloses System. Die folgende Checkliste bietet einen Rahmen für diese wertorientierte Vorgehensweise.
Ihr Aktionsplan: Vom Proof-of-Concept zum Proof-of-Value
- Business-Hypothese zuerst: Definieren Sie den messbaren Geschäftswert (z.B. „Reduzierung der Bearbeitungszeit um 25%“), bevor Sie die technische Machbarkeit prüfen.
- Mikro-Budget testen: Starten Sie mit einem minimalen Budget (z.B. 5.000 € statt 50.000 €), um die Kernhypothese schnell und kostengünstig zu validieren.
- KPIs vor dem Start festlegen: Legen Sie die exakten Erfolgsmetriken und den Zielwert fest, bevor das Projektteam mit der Arbeit beginnt.
- „Kill-Kriterien“ definieren: Bestimmen Sie im Voraus klare und unmissverständliche Abbruchbedingungen, falls der erwartete Wertbeitrag nicht nachgewiesen werden kann.
Wann sollten Sie Legacy-Systeme modernisieren statt ersetzen: Die 4 Kriterien, die eine 3-Millionen-Fehlinvestition verhindern?
Legacy-Systeme sind oft das Rückgrat des operativen Geschäfts, aber gleichzeitig eine Innovationsbremse. Die Entscheidung, ein solches System zu modernisieren (Refactoring, Replatforming) oder komplett zu ersetzen (Rip and Replace), ist eine der teuersten und riskantesten, die ein CIO treffen kann. Eine Fehlentscheidung kann Millionen kosten und das Unternehmen über Jahre lähmen. Auch hier bietet das Pareto-Prinzip eine datengestützte Entscheidungsgrundlage, die über rein technische Bewertungen hinausgeht.
Der Kern der Analyse ist die 80/20-Nutzung: Werden wirklich alle Funktionen des Altsystems intensiv genutzt, oder liefern 20% der Funktionen 80% des Geschäftswerts? Wenn letzteres zutrifft, könnte eine gezielte Modernisierung dieser Kernfunktionen (z.B. durch Kapselung in Microservices) weitaus wirtschaftlicher sein als ein kompletter Ersatz. Ein weiterer Faktor sind die technischen Schulden: Wie viele Ressourcen bindet die Wartung des Systems? Wenn mehr als 50% der IT-Ressourcen nur für die Instandhaltung aufgewendet werden, ist oft ein kritischer Punkt erreicht, an dem ein Ersatz unumgänglich wird.
Die Business-Agilität ist das dritte Kriterium. Blockiert das Altsystem mehr als die Hälfte aller neuen Geschäftsinitiativen, wird es zu einer strategischen Gefahr. Viertens muss die Daten-Gravitation bewertet werden. Liegt der eigentliche Wert des Systems in den über Jahrzehnte gewachsenen Daten oder in der veralteten Geschäftslogik? Wenn die Daten das Gold sind, kann eine Modernisierung, die den Zugriff auf diese Daten über moderne Schnittstellen ermöglicht, die bessere Strategie sein.
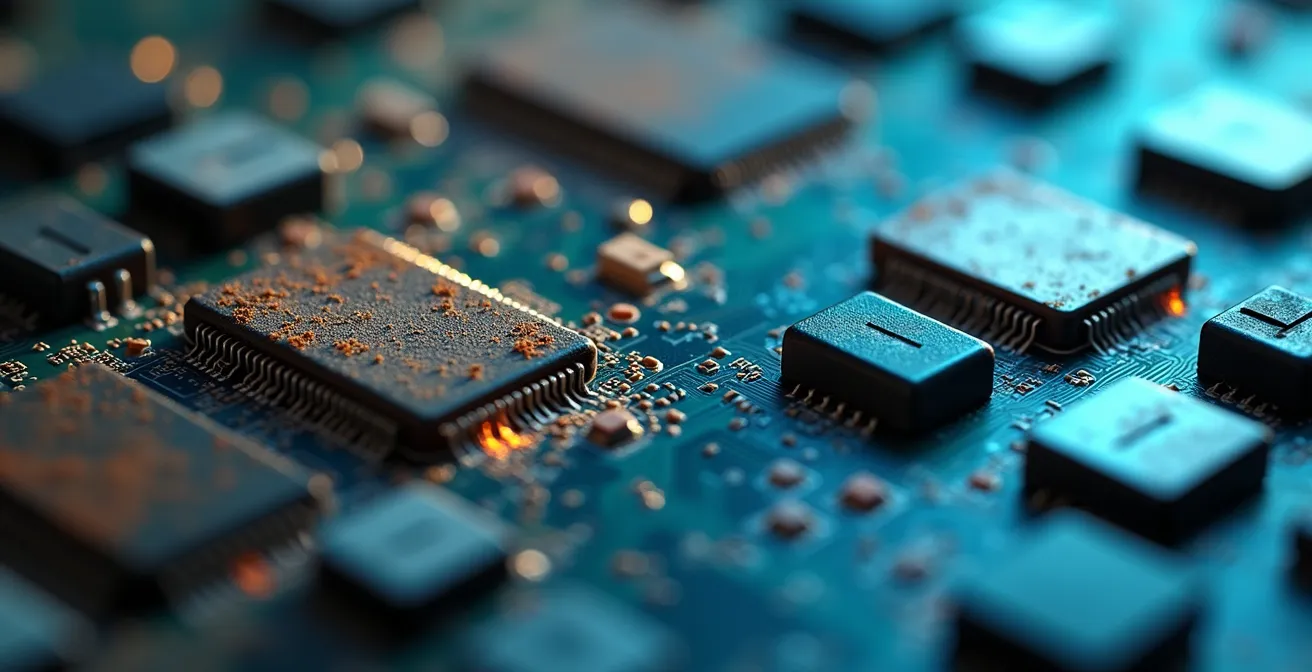
Die Entscheidung „Modernisieren vs. Ersetzen“ ist keine Glaubensfrage, sondern das Ergebnis einer nüchternen Analyse. Die folgende Tabelle fasst die zentralen Kriterien zusammen, die laut dem IT-Invest Monitor 2024 bei der Entscheidungsfindung helfen.
| Kriterium | Modernisieren | Ersetzen |
|---|---|---|
| 80/20-Nutzung | 20% der Funktionen liefern 80% Wert | Breite Nutzung aller Funktionen |
| Technische Schulden | <30% der IT-Ressourcen gebunden | >50% der IT-Ressourcen gebunden |
| Business-Agilität | Blockiert <20% neuer Initiativen | Blockiert >50% neuer Initiativen |
| Daten-Gravitation | Wert liegt in den Daten | Wert liegt in der Logik |
Der Anfängerfehler, der 70% aller E-Learning-Teilnehmer in den ersten 3 Wochen zum Aufgeben zwingt
Eine schlagkräftige IT-Organisation benötigt die richtigen Kompetenzen. Doch der traditionelle Ansatz der Weiterbildung – Mitarbeiter auf breiter Front in langen Kursen zu schulen – ist oft ineffizient und ein Paradebeispiel für Verschwendung. Der häufigste Fehler ist die Annahme, dass mehr Wissen automatisch zu besseren Ergebnissen führt. In der Realität zwingt dieser „Giesskannen“-Ansatz viele Teilnehmer zur Aufgabe und die erlernten Fähigkeiten sind oft schon veraltet, wenn sie tatsächlich gebraucht werden. Das Pareto-Prinzip bietet auch hier eine Lösung: Fokus auf die 20% der Skills, die 80% des Projekterfolgs ausmachen.
Statt Mitarbeiter in 6-monatige Zertifizierungsprogramme zu schicken, identifizieren Sie die konkreten Fähigkeiten, die für die nächsten strategischen Projekte (Ihre priorisierten 20%) benötigt werden. Dies ermöglicht ein „Just-in-Time“-Learning. Anstatt auf Vorrat zu lernen, eignen sich die Teams die benötigten Skills gezielt 2-3 Wochen vor Projektbeginn an. Der direkte Anwendungsbezug steigert die Motivation und den Lernerfolg massiv.
Dieser Ansatz lässt sich am besten in kurzen, intensiven „Skill-Sprints“ von maximal vier Wochen umsetzen. Anstelle eines Lern-Marathons, der die Mitarbeiter aus dem Tagesgeschäft reisst, ermöglichen fokussierte Sprints eine schnelle und anwendungsorientierte Kompetenzentwicklung. Es geht nicht darum, alles zu wissen, sondern das Richtige zur richtigen Zeit zu können. Diese Diskrepanz zwischen blosser Aktivität und tatsächlichem Erfolg zeigt sich auch auf strategischer Ebene, wo viele Unternehmen zwar Fortschritte melden, aber nur wenige signifikante Erfolge erzielen.
- Identifizieren Sie die kritischen Skills: Analysieren Sie Ihre wertorientierte Roadmap und leiten Sie die Top-3-Fähigkeiten ab, die für die Umsetzung der wichtigsten Projekte erforderlich sind.
- Implementieren Sie Skill-Sprints: Ersetzen Sie lange Schulungsprogramme durch kurze, intensive Lernphasen mit direktem Projektbezug.
- Messen Sie den Anwendungs-Erfolg: Bewerten Sie den Erfolg von Weiterbildung nicht am Zertifikat, sondern an der erfolgreichen Anwendung der neuen Skills im Projekt.
Warum verschwenden Ihre Mitarbeiter 30% ihrer Arbeitszeit mit Aufgaben, die keinen Kundenmehrwert schaffen: Die 7 Formen der Verschwendung?
Das Pareto-Prinzip ist eng mit den Ideen des Lean Managements verwandt, dessen zentrales Ziel die Eliminierung von Verschwendung („Muda“) ist. In jeder IT-Abteilung gibt es Prozesse und Aufgaben, die Ressourcen binden, aber keinen direkten oder indirekten Wert für den externen oder internen Kunden schaffen. Die Identifizierung dieser Verschwendungsformen ist ein entscheidender Hebel, um mit den bestehenden Ressourcen mehr Wirkung zu erzielen. Schätzungen zufolge werden beispielsweise bis zu 27% der Cloud-Ausgaben als verschwendet angesehen – ein klares Symptom für ungenutzte Ressourcen.
Die 7 klassischen Formen der Verschwendung aus der Produktion lassen sich direkt auf die IT übertragen und helfen, die „stillen“ Kostentreiber zu entlarven:
- Transport: Unnötige Datenbewegungen zwischen Systemen oder manuelle Übertragung von Informationen.
- Inventar: Überdimensionierte Serverkapazitäten, ungenutzte Softwarelizenzen oder auf Halde produzierte „Features“, die niemand nutzt.
- Bewegung: Mitarbeiter, die zwischen unzähligen Tools und Systemen wechseln müssen, um eine einfache Aufgabe zu erledigen.
- Warten: Warten auf Freigaben, auf Systemantworten oder auf Informationen von anderen Abteilungen.
- Überproduktion: Entwicklung von Funktionen, die der Kunde nicht nachgefragt hat, oder Erstellung von zu detaillierten Reports, die niemand liest.
- Überbearbeitung: Manuelle, mehrfache Qualitätsprüfungen, wo automatisierte Tests ausreichen würden, oder unnötig komplexe Lösungsarchitekturen.
- Defekte: Softwarefehler, Systemausfälle oder falsche Daten, die aufwändige Nacharbeit erfordern.
Ein „Verschwendungs-Audit“ auf Basis dieser 7 Kategorien ist ein mächtiges Werkzeug. Führen Sie mit Ihrem Team einen Workshop durch und identifizieren Sie für jede Kategorie die Top-3-Verschwender in Ihrer Abteilung. Wenden Sie dann das Pareto-Prinzip an: Fokussieren Sie sich auf die 20% der Verschwendungsursachen, die 80% der Probleme verursachen. Oft sind es wenige, aber tief verwurzelte Prozessschwächen, die den grössten Schaden anrichten.
Das Wichtigste in Kürze
- Wert über Technologie: Der Erfolg von IT-Investitionen hängt nicht von der neuesten Technologie ab, sondern von der konsequenten Ausrichtung auf messbare Geschäfts-KPIs.
- Fokus durch Pareto: Die 80/20-Regel ist ein strategischer Filter, um die 20% der Initiativen, Architekturentscheidungen und Skills zu identifizieren, die 80% des Business-Impacts liefern.
- Von PoC zu PoV: Ersetzen Sie technologiegetriebene Machbarkeitsstudien (Proof of Concept) durch wertorientierte Rentabilitätsnachweise (Proof of Value), um Hype-getriebene Fehlinvestitionen zu vermeiden.
Das vernetzte Zuhause: Wie Smart-Home-Systeme Ihnen 450 € Energiekosten pro Jahr sparen, ohne Komfortverlust
Auf den ersten Blick scheint die Architektur eines Smart Homes wenig mit der komplexen IT eines Unternehmens zu tun zu haben. Doch bei genauerer Betrachtung bietet sie eine perfekte Analogie für die strategische Entscheidung zwischen Best-of-Breed und integrierter Suite – und wie das Pareto-Prinzip hier zur Kosten- und Nutzenoptimierung führt. Auch im Smart Home stehen Nutzer vor der Wahl: Setze ich auf einzelne, hochspezialisierte Geräte verschiedener Hersteller (Best-of-Breed) oder auf ein geschlossenes, integriertes System wie KNX (integrierte Suite)?
Die meisten Anwender erzielen den grössten Nutzen (80% des Komforts und der Einsparungen) durch wenige, gezielte Automatisierungen (die 20% der Investition): intelligente Heizungssteuerung, automatisierte Beleuchtung in Schlüsselräumen und smarte Steckdosen für die grössten Stromfresser. Ein teures, voll integriertes System, das auch die Jalousien im selten genutzten Gästezimmer steuert, ist oft ein Beispiel für funktionale Überinvestition. Es wird für 100% der Funktionalität bezahlt, obwohl nur 20% den täglichen Wert ausmachen.
Diese Analogie ist direkt auf die Unternehmens-IT übertragbar. Ein spezialisiertes CRM-Tool (Best-of-Breed), das den Vertriebsprozess perfekt abbildet, kann mehr Wert schaffen als die mittelmässige CRM-Funktion eines riesigen ERP-Systems (integrierte Suite). Es geht darum, strategische „Investitionsinseln“ für die Kernprozesse zu schaffen, anstatt eine monolithische Landschaft zu verwalten. Wie eine Analyse von Social Media Examiner betont, liegt der Schlüssel oft in der gezielten Reduktion:
Mit 20% der Tools reichen die 20 Prozent, die 80 Prozent der Routinearbeit automatisieren.
– Social Media Examiner Analyse
Die Entscheidung für die richtige Architektur ist also keine rein technische, sondern eine ökonomische. Die folgende Tabelle überträgt die Smart-Home-Logik auf die Unternehmens-IT.
| Aspekt | Best-of-Breed (einzelne Smart-Produkte) | Integrierte Suite (z.B. KNX) |
|---|---|---|
| Investitionsfokus | 20% der Geräte für Kernfunktionen | Komplettpaket mit 80% ungenutzten Features |
| Flexibilität | Hohe Anpassbarkeit an individuelle Bedürfnisse | Standardisierte Lösung |
| Kosten-Nutzen | Gezielte Investition in wichtigste 20% | Zahlung für 100% Funktionalität |
| Analogie zu Unternehmens-IT | Spezialisierte Tools für Kernprozesse | ERP-Suite mit breitem Funktionsspektrum |
Die konsequente Anwendung des Pareto-Prinzips ist mehr als eine Optimierungstechnik – es ist ein fundamentaler Wandel der Denkweise. Es erfordert den Mut, „Nein“ zu sagen zu interessanten, aber nicht kritischen Projekten, und die Disziplin, sich auf den nachweisbaren Wert zu konzentrieren. Beginnen Sie noch heute damit, Ihre Projektpipeline, Ihre Systemlandschaft und Ihre Prozesse durch die 80/20-Brille zu betrachten, um die Weichen für eine wertschöpfende und zukunftssichere IT zu stellen.